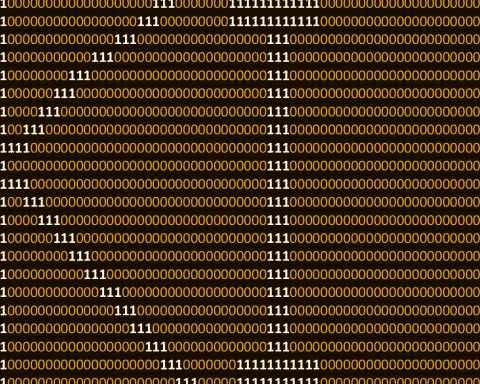Ein Gespräch zwischen Ralf Birkner, Leiter der Mobilen Spielaktion (Mobi) vom Stadtjugendausschuss, und dem Rektor der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Prof. Dr. Klaus Peter Rippe.
DS: Ich begrüße heute Ralf Birkner, Leiter der Mobilen Spielaktion vom Stadtjugendausschuss Karlsruhe, und Prof. Dr. Rippe, Rektor der PH Karlsruhe.
Die 17. Ausgabe der Druckschrift hat sich in ihrem Schwerpunkt dem Thema Bildung genähert, dazu möchten wir Sie als Experten bitten, unsere Leser durch die Informationen rund um das Thema zu führen. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben!
Herr Birkner, Sie sind direkt mit Kindern aktiv, betreuen Ausflüge und Gruppen..
RB: ..mit teils bis zu 150 Kindern. Wir haben eher große Gruppen.
DS: Herr Rippe, Sie sind als Rektor der PH für die Ausbildung der Ausbilder zuständig, die Kinder betreuen werden.
KR: Das geht über die Grundschulpädagogik bis zur Frühpädagogik bis hin zur Bildung im Alter, überspannt also die ganze Lebenszeit.
DS: Unter unserer Gesprächsanfrage liegt die Idee, dass Bildung schon immer auf ein gewisses Ziel führt, nämlich zu dem, was Kinder in und nach der Ausbildung tun. So wurde Wissen bisher derart vermittelt, dass gewisse Leistungsbegriffe bedient werden können. Denken wir an ein Technisches oder Humanistisches Gymnasium, die musikalische Ausbildung oder eine naturwissenschaftliche. Nun lassen uns Strukturen wie Open Source und das digitalisierte, öffentliche Wissen des Internet bereits vor der Verberuflichung auf spezialisiertes Wissen zugreifen.
Wie gehen Sie an der PH damit um, diese neue Wissenskultur zu verwalten? Gibt es Strukturen der Wissensethik, haben Sie hier den Umgang mit Wissen ändern müssen? Wie wird das in der Ausbildung der Lehrer und Pädagogen umgesetzt?
KR: Also das, was sich geändert hat, ist das sie einfach viel leichter Zugang haben zu Wissen, zu anderen Quellen. Es ist ja nicht so, dass man früher diese Möglichkeiten nicht gehabt hätte. Öffentliche Bibliotheken gibt es schon lange, die auch wissenschaftliche Literatur haben. Nicht-schulisches Wissen kann man auch an anderen Orten erwerben. Neu ist, daß man es mit so einem mobilen Gerät erreichen kann. Das heißt, man hat eine viel höhere Informationsmenge, auf die man zugreifen kann, in einer sehr schnellen Zeit.
Für unsere Studierenden ist es sehr viel schwieriger, mit diesen Dingen umzugehen, die Sachen auch sorgfältig zu lesen. Nicht immer nur schnell zu lesen, und nicht zu schnell zu ermüden, weil man einfach so viele andere schöne Dinge zur Verfügung hat. Und später im Betrieb der Bildungseinrichtungen müssen sie dann andere Leute mitnehmen, denen vermitteln, wie man damit umgeht, wie man sich nicht im Internet verrennt, sondern als ein Mittel unter vielen sinnvoll verwendet.
Diese Herausforderung haben wir, wir versuchen, gewisse Medienbildung verstärkt einzurichten. Eigentlich ein Phänomen, was in jeder Lehre stattfindet.
DS: Wie ist die Kommunikation unter den Jugendlichen und Kindern zu beobachten – findet da ein Bewusstsein statt, Herr Birkner?
RB: Ein Bewusstsein, unter dem Haufen der Informationen zu ertrinken? Ja, bei den Erwachsenen. Den Begriff des Haufens der Kommunikation stammt bereits aus den Achtzigern, da gab es noch nicht einmal Privatfernsehen. Die Idee, dass die Information schneller verfügbar ist, liegt schon lange vor. Die Frage des Umgangs, wie gelingt es den Menschen, damit sinnstiftend umzugehen, die können manche Erwachsene nicht, und Kinder vor allem nicht beantworten.
DS: Haben Sie, als Ethiker, dazu Hinweise?
KR: Die Forderung, dass es sinnstiftend sein würde, ist eine sehr hohe.
RB: Ja. Klar!
KR: Da würde ich sagen, dass tun die wenigsten. Als Ethiker gesprochen würde sinnstiftend bedeuten, dass man wieder Formen der Mäßigung einführt. Die Tugend Leere, da gibt es immer zu wenig und zu viel, der richtige Weg ist der Mittelweg. Und das gilt auch für Informationen. Es ist unsinnig, sich zu verschließen, sich abzukoppeln. Und genauso ist es unsinnig, voll reinzugehen und letztlich gar nicht mehr aufhören zu können. Die Mäßigung ist auch die Frage, wo liegt sie. Für einen Wissenschaftler ist die Antwort eine andere als für jemanden, der in einem sehr praktischen Beruf tätig ist.
DS: Wie praktisch gehen denn Kinder damit um?
RB: Mit Mäßigung? Ja gar nicht! Das ist ja auch nicht deren Notwendigkeit. Mal voraus gestellt: Ich bin jetzt seit 35 Jahren mit Kindern draußen unterwegs. Und die Kinder selbst haben sich relativ wenig verändert. Aber das, was wir Erwachsene für sie bereitstellen – das nennt sich dann Kindheit – das hat sich dramatisch verändert. Die Bedingungen, in denen Kinder aufwachsen, haben sich in den letzten 25 Jahren unglaublich verschoben. In den gefühlt letzten zehn Jahren hat sich durch die digitalen Bedingungen das auch für uns Erwachsene derart verändert, dass wir nun auch kaum hinterherkommen. Kinder haben weiterhin diese unbändige Sehnsucht nach Glück. Das Umfeld zu erzeugen ist vielleicht nicht eine pädagogische Frage, aber was da der Mittelweg sein soll, kann ich nicht beantworten.
Die höchste Kompetenz ist hier das Nein-sagen-Können. Dafür müssen wir Möglichkeiten bieten, das zu erlernen.
DS: Wie wird denn das in der Pädagogik vermittelt, dieses Nein-sagen-Lernen?
KR: Ist sehr schwierig. Letztlich eben eine Fähigkeit, die man nur in der Praxis selbst erlernt. Theorie allein kann das nicht, was allerdings geht, ist, im Unterricht gewisse Szenarien aufzubauen. Hier können Kinder etwas ausprobieren und mitnehmen, spielerisch oder nicht-spielerisch. Das Ziel ist aber, dass sie selbst es lernen, nicht, dass man es ihnen lehrt. Und genau das ist in der Pädagogik die Schwierigkeit. Wir müssen versuchen, Kinder in Situationen zu bringen, in denen sie merken, bestimmte Sachen gehen eben auch nicht.
Der Berg der Information ist für Kinder und Jugendliche erst mal nicht mehr als ein Bild. Relativ uninteressant. Mit vielen Informationen umzugehen und zu merken, ich komme nicht weiter, das sind die Erfahrungen, die letztlich etwas helfen. Das ist die Praxis, über die wir hier reden können.
RB: Bei uns beginnt der Kontakt im Grundschulalter. Früher war es so, du kannst zu Mobi kommen, wenn du deinen Schuh selbst binden kannst. Diese handwerkliche Fähigkeit wurde allerdings durch Klettverschlüsse aufgelöst. Der zweite Aspekt war, sie müssen den Weg zu uns allein bewältigen, sich allein in ihrem Streifraum bewegen können. Sich orientieren können und allein zurückfinden, Entscheidungen treffen können im geregelten Verkehr, das waren die Voraussetzungen. Dieses Selber-Machen ist eine sensationelle Möglichkeit. Wir plädieren hier aber eben auch für das Scheitern. Das wird oft genug nicht in den Vordergrund gestellt.
Das Spiel hat ständig diese scheinbare Qualität, da scheint immer die Sonne, die Kinder sind geschminkt und alle fröhlich. Tatsächlich aber hat das Spiel eben die Qualität, dass es eben mal nicht klappt!
DS: Kann das überhaupt in die Schule mitgenommen werden?
RB: Doch, das geht auch! Also in der Übertragung zu der digitalen Welt versuche ich einfach rauszukriegen, was ist denn für die Jugend so geil daran, beispielsweise Fortnite zu zocken? Das ist als Baller-Spiel noch relativ harmlos in deren Einschätzung. Da stehen ganze Fußballmannschaften noch Minuten vor dem Spiel zusammen und gucken, wer hat welche Qualitäten im Spiel.
DS: Kann das gemeinschaftsfördernd sein, dürfen wir das positiv sehen?
RB: Man kann da drin alles positiv bewerten. Letztendlich ist die Frage, was fasziniert die eigentlich? Gute Spiele sind die, in den Steigerungsmöglichkeit durch Scheitern funktioniert. Level bedeutet ja, ich habe das Nächste erreicht, wo ich mich wieder heraus wagen muss. Das sind die Qualitäten von Spiel. In unseren Waldaktionen bauen wir Hütten. Man stellt ja nicht Bretter zusammen, dann steht das Ding. Die allermeisten Hütten fallen erst mal zusammen. Dann muss man es nochmal probieren und nochmal probieren. Und das ist das eigentliche Synonym von Scheitern. Das stelle ich ich, egal, in welchen Entwicklungsräumen, in den Vordergrund. Wir müssen Möglichkeiten erzeugen, es selber tun zu können, es selber rauskriegen zu können, dass es mal nicht klappt.
Schulische Welten gestalten oft geregelter, zielgerichteter. Da muss es bei der selben Anzahl von Menschen relativ schnell auf dem selben Weg funktionieren. Menschliches Leben aber, der Versuch, das für sich Passende zu finden, ist aber nun einmal nicht gleich. Wir scheitern unterschiedlich.
KR: Ich denke, wir sind uns einig über das, was Lernen heißt. Lernen meint, dass ich in der Lage bin, selbst etwas zu tun. Das ist verbunden mit Anstrengung, nicht einfach mit Wiederholung. Ich muss es mir selbst erarbeiten. Also wäre guter Unterricht eine Situation, in der eine Person scheitert. Auch der Überflieger, die Überfliegerin muss scheitern können. Die Besonderheit der Lebenswelt Schule ist, wir haben gewisse Ziele, die auch von der Öffentlichkeit, vom Staat vorgeschrieben sind. Was die Eltern erwarten, dass die Rechtschreibung und Arithmetik beherrscht werden und so weiter. Das sind Vorgaben und man hat eine begrenzte Zeit. Und man hat eine Gruppe, die an dem selben Thema arbeitet. Das kriegt man nur hin, wenn man gemeinsam lernt und scheitert. Dieses Ziel hat einen gewissen Ernst, aber das blendet man eher aus.
DS: Interessant sind hier die Worte Vorgabe und Ziel. Da verschiebt sich in der Entwicklung der Arbeitswelt etwas, wir gehen davon aus, dass einige Arbeitsbereiche weniger stark vertreten sein werden, auch, dass Aufmerksamkeitsstrukturen sich ändern. Befürchtungen können sein, dass die Kinder etwas unkonzentrierter mit Aufgaben umgehen werden. Wie geht beispielsweise seitens der Bildungspolitik der Weg in Richtung neue Kindheit? Wie können in der Schnelligkeit sozialisierte Kinder in einen geregelten Lernbetrieb eingebunden werden?
KR: Ich weiß nicht, ob Kinder heute weniger Aufmerksamkeit haben. Der Zeitpunkt aber, an dem ich von einer Tätigkeit in die andere wechsle, ist sehr viel früher. Heutige Schüler sind gewohnt, wenn sie gelangweilt sind, dann wechseln sie den Kanal. Wobei das vielleicht schon ein veraltetes Bild ist, aus dem Fernsehen. Dieses Springen ist dann die Schwierigkeit.
Damit müssen Lehrerinnen und Lehrer heute umgehen. Wie bekomme ich die Aufmerksamkeit und wie behalte ich sie über eine gewisse Zeit. Es war noch sie so, dass das über 45 Minuten funktionieren konnte.
DS: Herr Birkner, sie grübeln?
RB: Ja. Die Qualitäten von Schule und Erwachsenenwelt in Bezug zu Kindern sind da, wo die Erwachsenen über die Kinder bestimmen. Und je höher die Fremdbestimmung, je geringer das Maß, sich einlassen zu wollen. Die schulische Welt ist immer strenger geworden, als dass Vorgaben gesetzt wurden in Hinsicht auf Leistung, auf Tempo, Fülle von Material, von dem irgendwelche Erwachsenen behaupten, dass Kinder das brauchen. Und dann wird der Berufsstand Lehrkraft damit malträtiert, dass die bestimmte Erwartungen noch erfüllen sollen. Da darf ja jeder mitreden heute. Jeder, der ein Kind hat, darf mitreden, wie Bildung zu funktionieren hat. Es ist ja phänomenal, wie Berufsfremde, wie Eltern einen Einfluss auf die Schulwelt kriegen. Das muss endlich aufhören.
Es reicht ja, wie Politik da Einfluss nimmt. Kommt die nächste Landeswahl, kommt damit der nächste Bildungsplan. Die sogenannten Fachleute bekommen ja von außen derart Aufforderungen, was sie alles mit den Kindern anzustellen haben. Die Möglichkeit, das miteinander zu entwickeln, wird ja immer geringer. Beispiel Aufmerksamkeit, da liegt die Spanne bei etwa zwanzig Minuten. Also würde die Möglichkeit, selber zu gestalten, wann ich mich in welchem Thema aufhalte, es da leichter machen. Das versuchen wir in Projektwochen, zum Beispiel in der Werkstatt des Wissens, zu erkunden, unter welchen, veränderten Bedingungen sich Wissen vermitteln lässt.
KR: Da laufen sie hier offene Türen ein.
RB: Stimmt, da sind wir mit der PH Karlsruhe ganz eng beieinander. Die Frage ist immer, wann gelingt es endlich, diesen Berufsfremden zu vermitteln, sie sollen jetzt mal die Klappe halten.
KR: Ein guter Unterricht hieße, Selbstbestimmung zuzulassen. Die Herausforderung ist immer noch, wir haben Klassenverbände – solange wir sie noch haben – und wir haben eben auch immer noch die Idee von Schule als Ort, an dem eine Generation einer anderen ein bestimmtes Wissen vermittelt. Das meint, man steuert ja etwas an. Und dieses Ansteuern und die Idee der Selbstbestimmung müssten eigentlich zusammenpassen. Es ist eine große Kunst. Wie bekomme ich Kinder dazu, das zu wollen, was ich als Lehrende*r auch möchte oder als Ziel habe.
Das Thema Fachfremde ist interessant. Da würde ich für die Eltern auch eine Lanze brechen. Einerseits ist es tatsächlich so, dass Eltern in der Tat mehr mitreden als früher. Das stimmt auch für Fachfremde. Man gilt heute sehr schnell als Experte. Sehr unglücklich, weil es eben das nimmt, was ein Experte ist, nämlich, dass man etwas sehr lange bearbeitet hat, sich in etwas hineinbegeben hat, wirklich mehr weiß, als andere.
Andererseits, und daher Lanze brechen – Eltern zeigen heute viel mehr Engagement. Sie kämpfen heute weitaus mehr, nehmen die Möglichkeiten wahr, sind nicht mehr so eingeschüchtert gegenüber den Autoritäten. Das hat durchaus etwas positives, dieses Hinterfragen.
RB: Keine autoritären Strukturen mehr zu akzeptieren in dem Sinne, dass jemand bestimmt, weil er etwas bestimmen darf, ja. In meiner und der generellen Rolle als Leitung, das gilt sicher auch für Andere, ist es so, dass wir Fachfremden erklären müssen. Aber wir müssen es eben auch erklären.
KR: Da habt ihr natürlich jetzt eine Schwierigkeit, ja.
RB: Aber, und da spreche ich auch als Elternteil, rennen Eltern eben in der Schule rum und sprechen nun einmal für das Interesse ihres eigenen Familiensystems. Elternvertreter sind da gezwungen, für das Solidarsystem Klasse etwas zu tun. Das gibt es bei Eltern fast nie, die rufen morgens an und sprechen für das eigene Kind. Deshalb widerspreche ich dem Solidargedanken der Einmischung.
KR: Ich habe mich ja auch auf das eigene Kind, nicht das Sozialsystem bezogen.
RB: Da kommt wieder der Leistungsaspekt ins Spiel. Mein Kind im Mittelpunkt. Wichtig ist, dass mein Kind kriegt, was ich will. Ich glaube, das narzisstische Prinzip ist so groß geworden, dieses Meins und Ich steht so im Vordergrund, dass gerade unser Berufsstand sich da abgrenzen müsste. Da müssen wir sagen, stopp mal, wir haben eine Gemeinschaft und zwar die der Kinder und die schützen wir vor den Erwachsenen.
KR: Da haben die Pädagoginnen, die Pädagogen ihre Aufgabe. Zu zeigen, wir haben eine Gruppe, um die muss es gehen. Und nicht um den Einzelnen, die Einzelne.
DS: Wobei das nun ein Bild ist, was in der nachschulischen Ausbildung nahezu wegfällt. Die dortige Leistungskultur führt bereits zum Einsatz von leistungsfördernder Medikation. Im folgenden Berufsalltag, in Konzernstrukturen erleben wir Durchsetzung und Gegeneinander. Und das ist vor Beginn eines Studiums beispielsweise bereits bekannt, dass sich oft nur der oder die Eine durchsetzt.
Das können wir mit der Celebrity-Kultur vergleichen. Wenn jemand die Leistung, die Anerkennung bekommt, bekommen Andere sie nicht. Die dürfen gratulieren kommen. Und das ist lange kein Geheimnis mehr, hat sich in Medien- und Werbungswelt durchgesetzt. Es ist ja nicht auszuschließen, dass es im Leistungsbegriff, den Schüler, Studenten und Lehrer entwickeln, bereits reflektiert und als Strategie angelegt ist. Davon kommen wir nun nicht mehr herunter.
Zudem liegt in dem angesprochenen Bildungs- oder Informationsplus nicht immer die einst erhoffte größere Sicherheit. Und zwar auch nicht als Selbstwahrnehmungsstabilität. Die Konkurrenz der Ideen ist dermaßen gewachsen, dass eben auch Experten nicht immer die zur Stabilisierung des Bewusstseins nötigen versicherten Antworten geben können. Was Solidarität leisten kann, ist unter der Kleinteiligkeit der neuen Messungen an sich sehr in den Hintergrund getreten.
War weniger Information vielleicht auch ein Mittel zu mehr Stabilität, zu mehr Solidarität?
KR: Wir haben ja auch in unserer hiesigen Kultur immer wieder Solidaritätswellen. Nehmen wir das Beispiel der Willkommenskultur der letzten Jahre. Und ich kann aus Sicht der PH auch sagen, dass sich die Studierenden hier etwas von den Studierenden der Kunst oder der Betriebswirtschaft unterscheiden. Da haben sie vom sozialen Engagement mehr vorzuzeigen, sind da etwas weiter.
Dass sie nicht nur an sich selber denken, zeigt schon, dass sie ein Studium wählen, aus dem heraus sie später nicht die Spitzenlöhne kriegen werden. Verallgemeinern können wir da nicht, auch Solidaritätswellen erfassen nicht alle. Aber es gibt einen erheblichen Teil unserer Bevölkerung, die solidarisch denken. Vielleicht endet das aber wiederum da, wo das eigene Kind betroffen ist, das ist möglicherweise ein Punkt, ja. Pfarrer´s Kinder, Müller´s Vieh, geraten selten oder nie, sozusagen.
Sicher ist Solidarität heute nicht wegzudiskutieren, steht aber in mehr Zusammenhang mit dem angesprochenen Narzissmus. Damit müssen wir uns tatsächlich auseinandersetzen.
RB: Leider haben wir wirklich eine Starkultur.
DS: Und wie wird das reflektiert in der Ausbildung? An der Waldorfschule hieß es früher – der Lehrer, dein persönlicher Held.
KR: Das muss natürlich reflektiert werden, ja. Wie geht man mit Vorbildstruktur um? Das ist Gegenstand einer Lehrerbildung, den richtigen Umgang mit sich selbst als Vorbild zu erlernen. Diese Rolle muss auch erlebt werden und spielt sicher bei der Berufswahl eine Rolle. Auch Herr Birkner ist sicher ein Vorbild.
DS: Wie können denn die, die nicht digital native sind, denen, die in die Digitalisierung hineingeboren wurden, Sicherheit vermitteln? Wie kann eine ältere Generation einer jüngeren, die zumindest andere Medienkompetenzen hat, ein Vorbild sein? Wie werden Lehrer dahingehend ausgebildet, das zu begleiten, was Kinder mit Medien tun?
KR: Für mich als Nichteingeborenen der digitalen Welt ist zu beobachten, dass Kinder handwerklich ganz anders, viel schneller und einfacher, mit diesen Dingen umgehen. Die gehen viel intuitiver heran, haben auch bestimmte kognitive Kompetenzen, die ich nicht habe. Im Spielen, zum Beispiel. Die eine Frage ist für mich, was will ich von denen lernen. Und die andere, was könne die wieder von mir lernen.
DS: Wie lernen denn die Lehrer von den Jungen?
KR: Insofern, als dass sie erst mal den Umgang mit den Medien wahrnehmen. Und daraus auch lernen, dass gewisse Dinge nicht als Problem wahrgenommen werden. Sie lernen, dass ganz andere Vorstellungen zu Ästhetik bestehen, zu Perfektion. Wir arbeiten hier beispielsweise viel mit visuellen Strategien. Da sind viele Studierende mit ihren Videos zufrieden, aber ihre Klassen wären es nicht. Da müssen wir den Studierenden vermitteln, dass andere Erwartungen bestehen, bezüglich der Handwerklichkeit, aber auch der Schnittfolge, der Geschwindigkeit.
Passend wäre der Vergleich zur Zeit des Übergangs vom Stumm- zum Tonfilm. Da sind nur sehr selektiv Dinge zu übertragen. Da wäre ich sehr vorsichtig, die Weisheiten des analog Geborene zu betonen.
RB: Schöner Satz. Die analog Geborenen haben, wenn sie denn wollen, den Vorteil, ein bisschen mehr begreifen zu können, was womit in Zusammenhang steht. Vorausgesetzt ist das Interesse, mit den anderen in eine Auseinandersetzung gehen zu wollen. Wenn sie darüber hinaus noch akzeptieren, dass sie nicht nur eine Rolle haben, nämlich Lehrende, sondern auch Lernende sind, also begreifen, dass sie selbst es nicht gleich wieder so gut können müssen, dann kann ein Verständnis entstehen, was sie selbst alles schon nicht mehr schaffen können, dass es aber geil ist, dass es das gibt.
Faszinierend ist für die, die schon länger auf dem Planeten herumlaufen, der Mensch in seiner Sinnlichkeit, als sinnliches Wesen. Das ist eben auch berauschend für die, die schön länger nachgedacht und häufiger mit anderen gesprochen haben. Wenn sie diese Qualität zur Verfügung stellen, ohne sie gleich zu bewerten, dann gibt es möglicherweise die Gelegenheiten, die jeweiligen Reichtümer zu teilen. Ich muss verstehen lernen, auch wenn es mich nicht berauscht, dass es berauschend ist. Ich muss aber auch das Signal geben können, worin es berauschend ist, und wofür es völlig unnütz und blöd ist.
DS: Schaffen die neuen Lehrer das denn noch? Die Lehrsituation ist wegen der Einstellungspolitk und der Vertragsdauer für manche auch frustrierend im Verhältnis zur Investition in digitale Mittel, wie jetzt aktuell mit dem 15 Millionen-Paket in Karlsruhe. Sollten da nicht eher mehr Lehrer eingestellt werden, die das Angesprochene auch vorleben können? Sehen Sie da Nachholbedarf, Herr Rippe?
KR: Insgesamt bräuchte es noch mehr Lehrer, und zwar gut ausgebildete. Das auf jeden Fall. Was momentan in einigen Bundesländern passiert, dass jene in den Lehrberuf übernommen werden, die vielleicht durch Prüfungen durchgefallen oder gänzlich fachfremd sind, führt zu Problemen in dem, was sie am Ende eben können sollten.
Ein bisschen haben wir jetzt das folgende Problem. Auch ein Studium ist endlich und wir müssen sehen, was kommt in die Curricula. Wir bauen jetzt digitale und Medienbildung verstärkt ein, das ist auch wichtig. Auch Umgang mit Heterogenität und Inklusion wird verstärkt. Das wird natürlich immer mehr und zum Glück hat sich das Lehrerstudium grade etwas verlängert. Grundschule und Sekundarstufe 1 beispielsweise.
Grundschule waren früher nur sechs Semester, das war sehr wenig für Akademiker. Da ist es gut, dass es nun Bachelor und Master gibt in dieser Richtung. Fraglich ist aber, wenn wir diese ganzen neuen Sachen aufnehmen, auf was verzichten wir auf der anderen Seite. Da haben wir Schwierigkeiten im Rahmen dieser endlichen Zeit eines Studiums. Was wir uns wünschen, sind Lehrer und Lehrerinnen, die weiterhin lesen und lernen. Das gehört einfach zum Lehrer, zur Lehrerin dazu. Und es ärgert mich, wenn das Gegenteil behauptet oder gar gelebt wird. Weiter- und Fortbildung sind elementar und die Aussage, man habe keine Zeit mehr zu lesen, ist ein sehr schlechtes Bild von der Grundschule. Es ist aber leider präsent. In den Lehrerzimmern fehlt es auch einfach an Literatur, das muss man mal so sagen.
DS: Können Sie das ausgleichen mit Ihrer Arbeit, Herr Birkner?
RB: Nein, überhaupt nicht. Wir haben da auch nichts zu sagen. Es sind ja auch nicht die Menschen, die darin agieren. Sondern eine auf sie wirkende Struktur der Anforderung, in immer weniger Zeit immer mehr zu leisten. Noch ein Thema dazu und dann noch eins. In meiner Wahrnehmung braucht es unglaublich viel Reflektionszeit und -raum. Also verschiedene Menschen, die miteinander nachdenken, was sie eigentlich tun, und vordenken, was sie vorhaben, zu tun. Dieser Zirkel braucht Zeit. Er kann nicht unter der Auflage einer Befristung liegen.
Je mehr Stress durch weniger Zeit wir Erwachsene uns auferlegen, umso weniger bekommen wir eine Reflektionsbegabung. Für mich ist in diesem Beruf eine der höchsten Künste die der Begegnung. Das Zusammenspiel und Nachdenken darüber, was tun wir eigentlich gerade miteinander. Das Belehrende, in welcher Form auch immer, sollte eigentlich den zweiten Teil ausmachen. Den ersten Teil reduzieren wir einfach auch so von der Zeit, dass mir auch keine Empfehlung mehr gelingt, wie mit den immer enger werdenden Erwartungen an diesen Berufsstand umzugehen wäre.
Jetzt soll beispielsweise das Thema Gesundheit und gesunde Ernährung in den Unterricht hineingenommen werden. Was soll denn das? Wir wissen doch, dass Kinder zunächst mal im Alltag des familiären Verbunds leben und lernen. Dort werden die Gewohnheiten angenommen, ein Miteinander beim Essen zum Beispiel. Was ist es für Unsinn, das über ein Schulfach zu vermitteln? Alles wird in die Schule verlagert, welch ein Blödsinn. Eine dramatische Veränderung.
Schule ist nicht der Mittelpunkt des Lebens. Jugendverbände machen so gute Sachen. Die suchen verzweifelt junge Menschen, die bei ihnen mitmachen. Nicht nur, aber auch im Kontrast zur digitalen Welt. Aber die Jungen haben keine Zeit mehr, weil alles in die Schule fließt. Ich rate dringend dem Rektor, wehrt euch, dass nicht jeder Käs in der Schule angesiedelt wird.
KR: Wir müssen uns auf zwei Ebenen wehren. Dasselbe gilt ja auch für die Hochschule.
RB: Ein Wahnsinn!
KR: Wir müssen eine nachhaltige Hochschule sein, eine bewegungsintensive..
RB: ..eine musizierende..
KR: … und so weiter! Das ist genau dasselbe Bild, dass diese vielen guten Ziele in einer Bildungsinstitution verkörpert seien müssen. In der Hochschule geht dann das Ziel unter, das man hier hat, nämlich dass Studium, Lehre und Forschung im Vordergrund stehen. Das sehen wir dann auch in der Schule, an den Lehrplänen. Die Aufgabe lautet nun, wie kriegt man die schlank?
Da sprechen wir mittlerweile nicht mehr von Wissen, sondern von Kompetenzen, die alle erzielt und erfüllt werden sollen. Wir haben hier eine Überfrachtung der Institutionen. Das fällt auch nicht weg, wenn wir auf Gesamtschule gehen. Da haben wir vielleicht einen gewissen Spielraum, auch Verbände einzubinden. Aber wieder wird immer mehr reingebaut. Ein realistisches Bild sollte sein, Schule hat eine Aufgabe, das Elternhaus eine andere, und dann gibt es noch die Freizeit, die sehr wichtig war und ist. Man sollte gewisse Prozesse eben auch an den Orten lassen, woher sie stammen und aus der Schule rauslassen.
RB: Dieses große Bild von der Bildungslandschaft. Als das aufgetaucht ist, hat man da immer einen Raum definiert, in dem ein großer Teil die Schule war, und andere Teile waren jenes und solches. Das hat sich dahingehend verändert, dass quasi nur noch ein Teil im Raum präsent ist. Und der in Abhängigkeit mit anderen kleinen Teilen, wie Vereinen, Verbänden, Musik- oder Sportvereinen, in irgendeiner Kommunikation steht. Die Erwachsenen konstruieren da eine ganz ulkige Welt, als wäre das alles irgendwie Schule. Die Kinder werden fast nur noch danach befragt, wie ist es für dich in dem schulischen Leistungssystem.
Diese Idee, dass Schule für etwas Wichtiges steht, kann doch nur funktionieren, wenn sie auch in einer Abgrenzung zu etwas steht. Zu etwas, wo auch andere zuständig sind. Und momentan gibt es eben aus meiner Sicht die Bestrebungen, diesen einen Teil, der Schule, mit allem zu füllen.
DS: Wessen Bestrebungen sind denn das, ist vielleicht die entscheidende Frage.
RB: Ich kann ja nur meine Wahrnehmung anbieten. Da ist erstens diese politische Erfindung von Chancengleichheit in der Ganztagsidee, von der man einfach weiß, das stimmt so ja nicht. Und der zweite Aspekt war schon immer die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das betrifft zunächst die Erwachsenenwelt, die Kinder müssen es dann wieder ausbaden. Für Kinderinteressen einzutreten, beispielsweise, wird politisch oft wieder kommuniziert mit dem Konzept, die Frau müsse zuhause bleiben. Das ist natürlich nicht so.
Wenn die Verantwortung der Männer für ihre Brut stärker wahrgenommen würde, wenn Männer also nicht so schrecklich leiden würden, weil sie keine 80 Prozent arbeiten in den Großbetrieben, könnte es endlich auch in Deutschland völlig normal werden, Zeit für seine Kinder zu haben. Dann könnten wir meines Erachtens auch die ersten zehn Jahre mal das Arbeitspensum reduzieren. Aber das machen eben nur Frauen, das ist zudem auch nicht angesehen hier.
Hier ist das fast philosophisch so, dass Erwachsene im Sinne der Leistungssteigerung und des wachsenden Wohlstandes mitarbeiten. Für die Kinder haben wir ein dazu passendes Konstrukt erschaffen, die werden dann jeden Tag immer in das eine gleiche Gebäude geschickt. Ein Irrsinn sondergleichen.
KR: Klar, für Politiker und Politikerinnen ist Schule ein Ort, an dem sie gestalten können. Im Elternhaus haben die keinen Einfluss, aus deren Sicht also folgerichtig, dass es in diese Richtung geht. Ich wäre vorsichtig, die Hoffnung auf die Vereine und Verbände zu setzen. Es kann sein, dass diese Struktur auch schon nicht mehr zeitgemäß ist.
RB: Die ist durch.
KR: Da gibt es deswegen jetzt eher spontane ad-hoc-Gruppen, die sich bilden und wieder lösen, was ja auch nicht negativ ist. Was diesen Gruppen aber oft fehlt, ist ein Ort. Da sind wir mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, mit dem Vereins- und Verbandsrecht, wieder hinterher. Denn das Engagement für bestimmte Themen, das ist ja da. Aber es ist nicht mehr der Verein, der seinen 40. Jahrestag hat, das ist in der Form vorbei.
Für die Gesellschaft wird es da also schwieriger, darauf zu reagieren, dahin etwas abzugeben. Bei der Gesamtschule lädt man den Sportverein ein, das geht. Mit so einer ad-hoc-Gruppe ist das komplizierter, dadurch, dass sich diese langen, traditionellen Gefüge etwas verändert haben.
RB: Und dadurch, dass alles unglaublich öffentlich ist. In dem Sinne, dass auf einen Knopfdruck Information sichtbar ist. Es ist ja alles unter Kontrolle, man kriegt irgendwie alles leichter mit. Die Pfadfinder vielleicht, die haben da traditionell nicht so eine Struktur, alle anderen haben diesen Stress, Mitgliedern etwas Neues zu bieten. Das hat aber auch damit zu tun, dass jedes Kind im Durchschnitt eine 40-Stunden-Woche hat. Die Kinder haben ja gar keine Zeit mehr, teilzunehmen.
Zudem findet das alles nicht mehr im sogenannten Streifraum statt, diese räumliche Bedingung ist ja auch abgeschafft. Kinder treffen sich nicht mehr einfach, gehen aus dem Haus und radeln halt mal irgendwo hin. Da sollte man gucken, wie man außerhalb der Schule Räume und Möglichkeiten schaffen kann. Nach der dritten Klasse haben wir da die Situation, dass die Schule ja auch so viele Aufgaben stellen soll, dass die Kinder lange damit beschäftigt bleiben.
Wir Erwachsenen haben da, in welcher Form, in welcher Rolle auch immer, ein Instrument erschaffen, spielen da einfach mit, eine Dynamik, einen Sog von Müssenmüssenmüssen. Es gelingt uns auch überhaupt nicht, eine Gelassenheit zu entwickeln, von ´Es wird auch ohne uns geschehen´. Da wäre Pädagogik gefragt. Diese kommt daher, den Menschen auf den Weg zu begleiten, sich selbst zu erschaffen.
Ich komme, vielleicht auch Sie, wir müssten etwa gleich alt sein, noch aus der Idee – mach dich überflüssig. Inszeniere Möglichkeiten, und dann geh weg davon. Erschaffe Bedingungen, es selber machen zu können. Jetzt muss man im Kindergarten schon jedes Kind beobachten und ein Portfolio erstellen. Es ist unglaublich, welche Aufgaben wir Erwachsene uns anmaßen, anstatt die Kinder auch mal selber machen zu lassen. Das ist ein Appell an uns selbst, mal zu sehen, was tun wir hier eigentlich? Was erwarten wir von Kindern?
Ich bilde auch aus und da versuche ich immer zu vermitteln ´Warum tust du das eigentlich?´. Unter welchem Zwang stehst du da eigentlich? Dieses böse Wort vom Arbeiten am Kind – furchtbar!
KR: Wenn wir jetzt in die Frühpädagogik gehen, zu der Frage, wo sind die Kinder – die sind da, wo die Erzieherin, der Erzieher nicht ist. Damit muss man dann aber auch umgehen und die Räume auch schaffen.
RB: Dazu bräuchten wir das Vertrauen, zu glauben, die Kinder stehen morgens nicht auf und fragen sich, wie bringe ich mich heute in größte Gefahr. Das Thema Aufsichtspflicht hat sich nicht geändert, zumindest in meiner Zeit. Aber der Umgang mit dem Thema hat sich phänomenal geändert.
KR: Der Umgang mit Risiken hat sich auf jeden Fall geändert.
DS: Je mehr wir wissen, umso weniger wissen wir, was auszuschließen ist.
KR: Vielleicht, ja…
RB: ..ich behaupte immer, warum wir als Pädagoginnen und Pädagogen unser Geld verdienen, ist, weil wir Wahrnehmungsprofis sind. Also wir müssen immer sehr schnell verstehen, was passiert da gerade. Ich muss das verstehen, ganz schnell, wie tickt dieser Mensch da gerade so? Wer in der Badischen Beamtenbank oder im Gartenbau arbeitet, muss das nicht unbedingt. Wir müssen das eben und das zum Beispiel unterscheidet uns dann auch von Eltern, die das nicht können, weil sie rollen-gebunden sind. Die Wahrnehmungen leiten unseren Weg und da wird Kindern auch vieles unterstellt, was nicht der Realität entspricht. Wenn wir da immer nur sehen, was alles passieren könnte, und dann noch die Rolle einnehmen, wir seien angeblich auch noch zuständig, das zu verhindern, dann werden wir unsere Kinder immer mehr verregeln und einsperren.
KR: Wir sollten sie begleiten.
RB: Das wäre sehr geschickt. Aber wir dominieren diese Verregelungen ja immer mehr.
KR: Und lassen das Kind da dann auch nicht mehr selber etwas tun.
RB: Und vertrauen den Kindern auch nicht mehr.
DS: Gibt es konkrete Stellen, die man ansprechen kann, unter dem Gefühl, dass beispielsweise Ihnen beiden nicht genug zugehört wird? Für mich sind Sie jetzt die Experten, aber wer kann Ihnen da nun mehr Geld und Gestaltungsraum geben für das, was ja hier fast im Konsens bedacht wird? Wieso wird das in die angesprochene Richtung entwickelt und nicht anhand Ihrer Vorschläge?
KR: Wir sind ja schon froh, dass wir jetzt ein paar Semester mehr haben.
DS: Können Sie das konkret beschreiben, wie sich das seitens der Bildungspolitik entwickelt hat? Wie wurde das erkämpft, kann man das überhaupt so sagen?
KR: Es ist eine Mischung, zum einen sind es die Lehrerverbände gewesen, die sicherlich dafür gekämpft haben, dass der Lehrerberuf als voller akademischer Beruf anerkannt wurde. Die Ausbildung, die dann auch zehn Semester dauern soll, erfordert auch ein Bewusstsein dafür, dass der Beruf etwas ist, bei dem man viel lernen muss. Zusätzlich ist dann der Nebeneffekt, dass der Lehrer Fachwissen haben muss.
Die Herausforderung, wie mache ich Unterricht, wie bringe ich Kinder dazu, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, sind Themen, die bildungspolitisch keinen sehr hohen Rang haben. Da wird momentan eher danach gefragt, wie bekommen wir Kinder dazu, dass sie sehr schnell lesen und schreiben können, ein Textverständnis und Rechenkenntnisse haben. Da geht man eher auf eine sehr spezifische Ebene und nicht auf eine, bei der es um allgemeine Persönlichkeitsentwicklung geht.
Also – die Vorgaben haben sich geändert. Und klar, Politiker brauchen natürlich auch immer Erfolgsergebnisse. Und solche Kennzahlen sind etwas sehr verführerisches.
DS: Nun sind ja die PISA-Ergebnisse nicht mehr nur hervorragend. Wann kann denn ein Umdenken stattfinden, auch seitens der Konzerne, dass eine geöffnete Wissenskultur auch wirtschaftlich rentabel ist in ihrer Rückkoppelung? Vielleicht nicht in der ersten Konsequenz, aber doch in der dritten oder vierten, tut es einem System ja gut, in Wissenskultur zu investieren und nicht nur in Leistungsmaschinen. Die Beobachtung ist ja nun bereits Vergangenheit, die Ergebnisse sind Gegenwart, was also bedeutet das für die Zukunft? Wie reagiert denn da die Politik, auch unter dem Verständnis, dass Bildungspolitiker abhängig sind von den zugewiesenen Geldern?
KR: Die empirischen Befunde, die man hat, sind sehr hilfreich. Wie sie dargeboten werden, nämlich als Rankings, stellt allerdings ein Problem dar. Dieses Denken – jetzt sind wir in Baden-Württemberg schlechter als die Sachsen – ganz schlimm. Von den Zahlen selbst lernen wir, wie hat sich denn Baden-Württemberg entwickelt? Hier sind zum Beispiel bestimmte Kompetenzen zurückgegangen, in bestimmten Schülergruppen. Das verdient Aufmerksamkeit. Wie können wir das verbessern?
Was aber diskutiert wird, ist: wir fallen zurück gegenüber Anderen. Nicht: wir sind jetzt schlechter geworden, als früher. Was hat sich geändert? Was müssen wir ändern? Der zweite Punkt ist der – dadurch, dass wir nur sehr wenige Kennzahlen haben, blenden wir andere Dinge aus. Da fehlen gewisse Grundfertigkeiten. Ihr Gebiet, zum Beispiel, die ästhetischen Kompetenzen, werden von PISA nicht erfasst.
DS: Der Horizont, in den Ästhetik eingefasst wird, scheint mir immer dünner zu werden. Vielleicht müssen wir fragen, wie ändert sich die Anwendung, die Einbindung von den oben angesprochenen Kompetenzen durch neue Medien. Wieso scheint vieles so gut, was so kurze Reichweiten hat?
KR: Wir sollten herausfinden, was ändert sich denn, wenn ich ein E-Book nutze im Verhältnis zum Papier? Oder wenn ich ein Hörbuch höre, was passiert mit meinem Textverständnis? Das sind genau die Punkte, die in die Lehre reinmüssen, ja. Das müssen die späteren Lehrerinnen und Lehrer dann sinnvoll einsetzen.
DS: Die Frage ist ja auch, wo findet das alles denn statt? Bleibt dieses In-die-Lehre-reinsetzen den Lehrern vorbehalten oder sollten wir nicht bei den Kindern anfangen, denen erklären, was die neuronale Ebene kann, wo Informationen verarbeitet werden und in welchem Zusammenhang diese neuronalen Netze Handlungsentscheidungen treffen?
KR: Da verstehen wir noch sehr wenig. Was wir aber wissen, dass der Einsatz verschiedener Medien entsprechende Hirnareale verändert. Das ist eine Frage, die uns als Hochschule aber als Forschungsfrage interessiert. Wie sieht zum Beispiel wissensbasierte ästhetische Bildung aus? Genau das ist spannend, das muss uns interessieren. Lesen und Schreiben sind wie Bewegung Grundkompetenzen, auf die sich Schule nicht beschränken darf. Das angesprochene Andere muss ebenso gesehen werden.
RB: Alles hat die Bedeutung, die wir geben. Wenn wir dann so Bilder konstruieren, wir sind laut PISA so gut oder schlecht, gibt das einfach nur eine diffuse Aussage. Und irgendjemand muss jetzt etwas tun. Wenn wir uns immer wieder in dieses einfache Schema rein begeben müssen, auch weil Politiker es manchmal gerne so tun, gibt es auf die obige Frage nur die Antwort – keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ändern kann, weil diese Bilder so stark instrumentalisiert werden.
Schule hat eine ganz andere Aufgabe, den Mensch in der Entfaltung seiner eigenen Potentiale zu begleiten. Die Aufgabe, Menschen Möglichkeiten zu bieten, rauszukriegen, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was macht mich aus als Mensch. Und zwar in jeder Kompetenz, auch in der kommunikativen und der sozialen. Aber wenn weiter so mit Ranglisten gearbeitet wird, hat man dazu kaum eine Chance.
Dagegen unterstelle ich übrigens mal, dass wir ja alle leistungswillig sind! Wenn wir mal von einem Menschenbild ausgehen wollen, dass wir gern staunen und in dem großen Universum unseren Platz finden wollen, dann müssen wir Erwachsene auch mal daran denken, dass wir es vielleicht zusammen, mit den Kindern, schaffen wollen. Hin zu der Frage, was ist denn so lebenswert an diesem Leben. Mit Achtsamkeit-Kursen wirst du momentan Millionär. Setz den Menschen mal ein Wochenende ohne Smartphone in die Sonne, das finden alle großartig, weil wir als sinnliche Wesen berücksichtigt werden wollen. Und wir sind emotionale Wesen, und das sollte in der Schule auch einen Platz finden.
Solange das keine Rolle spielen darf, wird die Schule, auch die PH, immer in der Not stehen. Das ist unser Drama. Die Spielpädagogik hat einen gigantischen Vorteil. Das Spielen ist ökonomisch völlig nutzlos. Man kann es auch nicht messen. Man kann aber sagen, dass die, die spielen, sich gut fühlen. Das ist Sinnhaftigkeit.
KR: Deswegen ist Spielen auch eine so große Industrie. Lassen Sie mich noch etwas optimistischer sein, als wir eben geklungen haben. Wenn jetzt Bildungspolitiker*innen hier bei uns gesessen hätten, hätten die nicht anders geklungen. Deren Schwierigkeit ist, wie kann ich das in deren Wahlkreis rüberkriegen? Und dann kommen die Verkürzungen und Verknappungen. Das Problem sind die Vereinfachungen in den politischen Diskursen mit der Öffentlichkeit. Das führt zu diesen Verzerrungen, über die wir heute gesprochen haben.
DS: Da schließt sich der Kreis zu einer Wissens- und Diskussionskultur, die wir jetzt schon erleben. Die, die wählen und Nein sagen könnten, sind teils gar nicht mehr in der Lage, mit differenzierten, längerfristig entwickelten Aussagen umzugehen. Ich wünsche uns sehr, dass wir einen genussvolleren Umgang mit Information bekommen.
KR: Das nehmen wir als Schlusswort.
RB: Klingt doch gut, einverstanden.
DS: Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch!
Das Gespräch führte Robert Loos von der Redaktion.